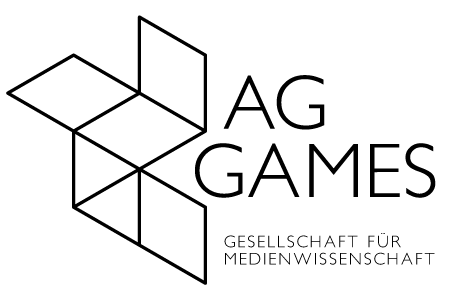Unter dem Motto „Spielkulturen“ findet vom 28.–29. November 2025 die Jubiläumskonferenz des Arbeitskreises Geisteswissenschaften und Digitale Spiele (AKGWDS) online statt. Bei der Veranstaltung wird das zehnjährige Bestehen des AKGWDS gefeiert. Abstracts können noch bis zum bis zum 30. April 2025 eingereicht werden.
Spiele fungieren sowohl als bedeutender Spiegel der zeitgenössischen Kultur als auch als treibender Faktor für deren Weiterentwicklung. Sie reflektieren die kulturellen Gegebenheiten und Werte ihrer Entstehungszeit und tragen gleichzeitig zur Bildung von Spielkulturen bei, die sich in vielfältigen Formen und verschiedenen medialen Formaten manifestieren. In der Gamesbranche entwickeln sich bestimmte Arbeitskulturen. Es entstehen kulturelle Debatten über Spiele, die sich im Spannungsfeld zwischen den Interessen und Perspektiven von Entwicklungsstudios, Spielenden, Medien und der wissenschaftlichen Rezeption entfalten. Dabei entstehen wiederum eigene Vermittlungs- und Forschungskulturen. Um die verschiedenen Aspekte der Verbindungen zwischen Kultur(en) und Spielen vollständig zu erfassen, sind sowohl unterschiedliche disziplinäre als auch interdisziplinäre Ansätze erforderlich.
In der Forschung ist der Zusammenhang von Kultur und Spiel kein neues Thema, so trägt eine der bekanntesten Fachzeitschriften den Namen Games & Culture, eine Konferenzserie befasst sich mit Video Game Cultures (https://videogamecultures.org/),das Handbuch Gameskultur (2020) versuchte das Thema einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und schon der Kulturhistoriker Johan Huizinga widmete sich in den 1930ern dem Verhältnis von Kultur und Spiel. Jedoch ist das Themenfeld noch lange nicht vollständig erschöpfend behandelt worden. Das Thema und die damit verbundene Forschung haben sich in den letzten Jahren dynamisch entwickelt und sind daher von großem Interesse für eine zeitgemäße und systematische Untersuchung.
Der AKGWDS, der sich als Zusammenschluss von Wissenschaftler*innen verschiedener Disziplinen versteht, möchte daher dazu einladen, gemeinsam über die vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen Kultur(en) und Spielen nachzudenken und gleichzeitig sein zehnjähriges Bestehen in verschiedenen wissenschaftlichen und unterhaltsamen Formaten zu feiern. Dabei spielt auch eine Rolle, dass der Arbeitskreis 2024 seinen Namen geändert hat und das G nun für Geisteswissenschaften und nicht mehr für Geschichtswissenschaften steht. Geschichte im Spiel und Spiele als Geschichte sind nach wie vor sehr wichtige Themen für den Arbeitskreis, aber darüber hinaus hat sich der Fokus erweitert und liegt nun an der Schnittstelle zwischen Game Studies und verschiedenen geisteswissenschaftlichen Disziplinen wie Geschichte, Geschichtsdidaktik, Kulturwissenschaften, Gender Studies, Soziologie, Literaturwissenschaft, Medienwissenschaft, Linguistik, Politikwissenschaft oder Wirtschaftswissenschaften. Ziel und Motivation des Arbeitskreises ist es auch weiterhin, der Forschung zu digitalen Spielen einen prominenten Platz in Wissenschaft und Gesellschaft zu verschaffen. Auch wenn hier in den letzten zehn Jahren einige Fortschritte erzielt werden konnten.
Themenkomplexe
Für die diesjährige Online-Konferenz zum Thema Spielkulturen lädt der AKGWDS insbesondere dazu ein, Beiträge zu den folgenden Themenschwerpunkten einzureichen:
- Metadiskurse
Wie so oft beginnt die Diskussion eines Themas mit der Definition von Begriffen. Wenn wir über Spielkultur oder Spielkulturen sprechen oder schreiben, was meinen wir dann genau? Historische Begriffe wie „Spiel“ und „Kultur“ und auch neuere Begriffe wie “Games” haben eine Vielzahl von Verwendungen erfahren und lassen sich daher kaum mehr auf eine einzige Definition herunterbrechen. Dieses Thema befasst sich daher unter anderem mit der Begriffsgeschichte und den verschiedenen Definitionen von Spiel und Kultur, wobei unsere Vorstellung von diesen beiden Konzepten auf den Prüfstand gestellt wird. Vor allem aber geht es darum zu untersuchen, welche übergreifenden Überlegungen hilfreich sind, um eine wirksame Erforschung der Beziehung zwischen Spiel und Kultur zu unterstützen.
- Methoden und Ansätze
In diesem Themenkomplex soll es vor allem um Methoden und Ansätze bei der Forschung im Bereich Geisteswissenschaften und digitale Spiele gehen. Zu Beginn seiner Existenz hat der Arbeitskreis einen vielzitierten Leitfaden (2016, https://gespielt.hypotheses.org/manifest_v1-1) für die Arbeit im Bereich Geschichtswissenschaft und digitale Spiele entwickelt. Eine Frage ist, ob zehn Jahre später ein solcher Leitfaden überhaupt noch nötig beziehungsweise möglich ist. Dazu kommt, dass sich durch die Umbenennung des Arbeitskreises die Themenfelder vervielfältigt haben. Daher kann man sich fragen, inwieweit sich die vielfältigen Ansätze und Methoden der Geisteswissenschaften in Bezug auf (digitale) Spiele ordnen lassen. Vor allem aber soll es in diesem Themenkomplex darum gehen, welche Methoden und Ansätze aus den unterschiedlichen Geisteswissenschaften aktuell und zukünftig am vielversprechendsten für die Auseinandersetzung mit Spielen sind.
- Kultur in Spielen
Dieses Themenfeld widmet sich der Analyse digitaler und analoger Spiele mit einem besonderen Fokus auf deren Repräsentation kultureller Elemente. Es wird untersucht, wie spezifische Spiele kulturelle Phänomene darstellen, welche Mechanismen und Strategien sie hierfür einsetzen und welche kulturellen Diskurse daraus hervorgehen. Dabei werden insbesondere die Beziehungen zwischen Spielgenres, kulturellen Repräsentationen sowie narrativen und ludischen Strategien betrachtet. Im Zentrum dieses Themenfeldes stehen daher Fallstudien, die einzelne Spiele, Spieleserien oder thematisch oder spielmechanisch miteinander verbundene Werke analysieren.
- Rezeptions- und Vermittlungskulturen
Das Themenfeld rückt die Rezeption und Vermittlung (digitaler) Spiele in den Mittelpunkt. Im Fokus steht die differenzierte Untersuchung der Rezeptionskulturen und der Vermittlungsformen, die sich um digitale Spiele herausbilden. Es wird analysiert, wie (digitale) Spiele und ihre thematischen Inhalte von verschiedenen Akteur*innen – Spielenden, Medien, Journalist*innen, Influencer*innen, Entwicklungsstudios sowie der Wissenschaft – wahrgenommen und verarbeitet werden beziehungsweise welche Zugänge zu (digitalen) Spielen angeboten werden. Dabei stellen sich zentrale Fragen: Welche Rezeptionskulturen dominieren in bestimmten Gruppen? Wie können die oft komplexen Wechselwirkungen zwischen diesen Akteur*innen angemessen analysiert und verstanden werden? Welche Strategien lassen sich identifizieren, mit denen Themen gesetzt und Diskurse geprägt werden? Welche Vermittlungskulturen lassen sich erkennen und welche Strategien dominieren diese?
- Entwicklungskulturen
Themenfeld fünf beschäftigt sich mit der Seite der kulturellen Industrie und der Rolle der Spieleentwickler*innen. Hier kann bereits die Problematik, dass Informationen nicht immer leicht zu bekommen sind, diskutiert werden. Andere Themen sind Arbeits- und Unternehmenskultur bei den Produzent*innen (digitaler) Spiele. Wer stellt (digitale) Spiele her? Welche Ausbildungen haben die Entwickler*innen? Wie lassen sich die Arbeitsprozesse und die Unternehmenskulturen beschreiben? Welche Unterschiede gibt es bei Vergleichen des D-A-CH-Raumes mit anderen Regionen?
- Forschungskulturen (Wissenschaft und Spiele, Geschichte des AKGWDS und Forschungsgeschichte)
Das abschließende Themenfeld widmet sich dem wissenschaftlichen Schaffen und untersucht Wissenschaftskulturen im Kontext der Geisteswissenschaften und (digitalen) Spiele. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Spielen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten entwickelt hat, insbesondere im deutschsprachigen Raum (D-A-CH) und welche Entwicklungen es zukünftig zu beachten gilt. In diesem Abschnitt soll anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des AKGWDS auch die Rolle des Arbeitskreises bei diesen Entwicklungen diskutiert werden.
Formate
Um die Breite verschiedener Zugänge zum Thema “Spielkulturen” auch auf der formalen Seite abzubilden, bietet die Tagung verschiedene Formate zur Beteiligung an:
- Poster-Präsentation
- Micro-Talk (ca. 5 Minuten, Impulsvortrag)
- Science Slam (ca. 10 Minuten, Kurzvortragsturnier)
- Vortrag (20 Minuten)
Darüber hinaus können auch gemeinsame Formate eingereicht werden:
- Panel (Gemeinsames übergreifendes Thema, 3 Vortragende, jeweils 20 Minuten Vortrag)
- Roundtable (Diskussionsrunden zu einem Thema. 3-5 Teilnehmer*innen, Moderation möglich)
- Workshop (60 bis 90 Minuten, partizipatorisches Format mit Übungsanteilen)
Wir bitten um Angabe des angestrebten Formats zu Beginn des Abstracts.
Einreichung von Beiträgen
Wir suchen Themenvorschläge aus den Bereichen Wissenschaft, Entwicklung, Vermittlung, Pädagogik usw. zu geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Fragestellungen in Bezug auf Kulturen digitaler und analoger Spiele. Die Vorschläge können bis zum 30. April 2025 in Form von Abstracts im Umfang von bis zu 300 Wörtern plus kurze biographische Angaben per Mail an tagung@akgwds.de mit dem Betreff [Spielkulturen] eingereicht werden.
Der AKGWDS sieht sich der Förderung junger Wissenschaftler*innen verpflichtet. Daher nehmen wir Vortrags- und Panelvorschläge von Personen aller Karrierestufen entgegen und stehen jederzeit, insbesondere für die Beratung von Nachwuchswissenschaftler*innen sowie die Beantwortung etwaiger Fragen, zur Verfügung.
Die Konferenz soll vollständig digital stattfinden. Vortragssprachen sind Deutsch und Englisch und die Diskussionssprache ist Deutsch. Alle Personen, die ein Proposal einreichen, werden spätestens bis Mitte Juni über die Annahme oder Ablehnung sowie über weitere Details zur Konferenz informiert.
Wir freuen uns auf eure Beiträge!